Hannah Arendt und Theodor W. Adorno: Eine Feindschaftsbeziehung? Seminarleitung: Eva von Redecker Als eine „abscheuliche Gesellschaft“ bezeichnete Arendt einmal die Frankfurter Schule: der Marxist Adorno käme ihr nicht ins Haus. Adorno selbst nannte sie deshalb ein „altes Waschweib“. Die persönliche Feindschaft zwischen Arendt und Adorno ist an unzähligen Stellen belegt. Philosophisch werden die beiden AutorInnen jedoch tatsächlich kaum... weiterlesen

Programm
„Möglichkeitssinn“, Konkurrenz und Optimierung. Robert Musils »Mann ohne Eigenschaften« und die Ökonomisierung des Sozialen Seminarleitung: Michael Makropoulos In der individuellen Fähigkeit zur Selbstverwirklichung sahen bereits die Aufklärer des 18. Jahrhunderts die Autonomie des Subjekts gegen die Zwänge der Tradition begründet. Was man mit großem emanzipatorischen Pathos ‚Freiheit’ genannt hat, ist die Realisierung unverwirklichter Möglichkeiten. Robert Musil hat in... weiterlesen
Frantz Fanon über (anti-)koloniale Gewalt: Ein politischer Skandal Seminarleitung: Onur Erdur Man nennt es das kommunistische Manifest der antikolonialen Revolution. Nicht nur die Befreiungsbewegung in Algerien ließ sich von Fanon inspirieren, sondern beispielsweise auch die US-amerikanische Black Panther-Bewegung und der palästinensische Widerstand gegen die israelische Besatzungspolitik. Fanons 1961 veröffentlichtes Werk »Die Verdammten dieser Erde« löste einen heftigen Skandal... weiterlesen
Klimawandel, Überwachung, ein entfesselter Kapitalismus – wo gegenwärtige Zustände vorwiegend in Form permanenter Krisenhaftigkeit gedacht werden, bleibt auch die Zukunft nicht verschont. Utopische Entwürfe werden rar, vielmehr dominieren Schreckensszenarien den Diskurs: Dystopien haben im Moment Hochkonjunktur. Auch die Literatur der Gegenwart wendet sich in verstärkt dystopischen, anti-utopischen Szenarien zu: sie erzählt vom Verlust der Identität im digitalen Zeitalter, von totaler... weiterlesen
Die Unterscheidung von „Massenkultur“ und „Kulturindustrie“ steht nicht nur für die semantische, sondern auch für die sachliche Differenz, in der es um die theoretische Bestimmung und die politische Bewertung der ‚Ästhetisierung des Sozialen‘ im 20. Jahrhundert geht. Diese Differenz konzentriert sich in der Frage, ob die Technisierung oder die Ökonomisierung des Ästhetischen das entscheidende Moment einer Vergesellschaftung ist, die nicht... weiterlesen
Seminarleitung: Antonio Lucci und Nicola Zambon Contact und contagious, contatto und contagio: die englische und die romanischen Sprachen weisen gemeinsame etymologische Wurzeln von zwei Begriffen auf, Berührung und Ansteckung, die miteinander deutlich verzahnter sind, als wir es noch bis vor kürzester Zeit wahrnehmen konnten. Doch der naturwissenschaftliche Befund, eine Krankheit könne sich auch durch Berührung verbreiten, ist eine späte... weiterlesen
Seminarleitung: Jenny Kellner Der französische Autor Georges Bataille, in Deutschland vor allem für seine erotischen bis pornographischen Erzählungen bekannt, war nicht nur Literat, sondern auch Kritiker, Essayist und Philosoph. Seine Theorie einer „allgemeinen Ökonomie“ findet heute, angesichts der Sackgassen, in die eine bereits als Ende der Geschichte deklarierte Weltwirtschaftsordnung zunehmend gerät, verstärktes Interesse. Die allgemeine Ökonomie Batailles... weiterlesen
Erzählungen von Freundschaft zwischen Frauen haben in der zeitgenössischen Literatur Konjunktur. Gleichzeitig lässt sich auch im akademischen Diskurs über Freundschaft – in den Literatur- und Kulturwissenschaften, der Philosophie und Soziologie – eine feministische Neuverhandlung eines Themas beobachten, das über Jahrhunderte hinweg eher männlich geprägt war. Das Seminar möchte dem Phänomen der Freundinnenschaft auf den Grund gehen, indem es zum einen... weiterlesen
Grüner Sozialismus – was die ökologische Krise mit Eigentums- und Klassenverhältnissen zu tun hat
In der Klimabewegung ist heute oft die Rede davon, man solle sich nicht mit den Systemdebatten des 20. Jahrhunderts aufhalten, sondern ‚nach vorn gewandt‘ über gesellschaftliche Veränderungen nachdenken. Das klingt in Anbetracht der verheerenden Umweltbilanz der sozialistischen Staaten auf den ersten Blick sehr vernünftig. Trotzdem stellt sich die Frage, ob sich die ökologische Krise der Gegenwart ohne Kapitalismuskritik verstehen lässt.... weiterlesen
Corona, Care & Commons – Von ‚Lohn für Hausarbeit‘ zu ‚Care Revolution‘
Die Corona-Pandemie hat die Krise der Care-Arbeit verschärft: In Krankenhäusern mangelt es an Pflegepersonal, die bisherigen Pfleger:innen sind überarbeitet und schlecht bezahlt. Angehörige von Menschen mit Behinderungen müssen während der Schließung von Einrichtungen deren Betreuung und Pflege übernehmen. Eltern verzweifeln an der Anforderung, im Homeoffice ihren Dienst zu erfüllen und zugleich kleinere Kinder zu betreuen oder größere im Homeschooling anzuleiten.... weiterlesen
Muttertochtertexte
Kaum eine menschliche Beziehung ist so komplex wie die zwischen Mutter und Tochter. Denn kaum eine ist so eng. Mütter und Töchter unterstützen und verletzen sich, sehnen sich nach gegenseitiger Nähe und ringen um Abgrenzung. In unserem Seminar diskutieren wir zwei literarische Darstellungen dieser sozialen Beziehung – Elena Ferrantes Lästige Liebe (1992) und Annie Ernaux’ Eine Frau (1987).... weiterlesen
Anderes Eigentum
Unsere Zivilisation ist beherrscht vom Privateigentum: Jedes Ding und jeder Gegenstand gehört jemandem, alles ist wie unsichtbar mit einem Namen bedruckt. Das private Eigentum ordnet alles irgendjemandem zu, egal ob das mein Lieblingsfüller ist, mit dem ich seit Jahren jeden Tag schreibe oder eine Aktie, die mir fiktiv ein Eigentum an irgendeinem Konzern auf einem anderen Kontinent bedeuten soll. Es... weiterlesen
„Ich will, dass Du bist!“ – Hannah Arendt und Martin Heidegger über Liebe
„Amo heißt volo, ut sis, sagt einmal Augustinus: ich liebe Dich – ich will, daß Du seiest, was Du bist.“ Diesen außergewöhnlichen Satz schreibt Heidegger am 13. Mai 1925 an seine Studentin – und Geliebte – Hannah Arendt. Wie grundlegend für Heidegger das Augustinus Zitat war, zeigt, dass er sich nicht nur in der persönlichen Korrespondenz auf diese Formulierung beruft,... weiterlesen
Multiple Geschichten erzählen – nach Donna Haraway
Zur Bewältigung der Klimakrise, der politischen und sozio-ökonomischen Verhältnisse der Gegenwart findet ein vernetzendes und verflechtendes Denken immer mehr Verbreitung. Es geht um ein Denken, das der Arbeit an komplexen Weltzusammenhängen gerecht werden möchte, indem es die Multiplizität dieser Vorgänge in sich aufnimmt – um Geschichten für eine andere Zukunft zu erzählen. Eine der prominentesten Vertreter:innen eines solchen hybriden Denkens ist... weiterlesen
Autofiktion. Eine Literaturwerkstatt
Die Autofiktion ist Hoch im Kurs. Ob Annie Ernaux, Édouard Louis oder Didier Eribon, sie hat momentan das Potenzial zum Bestseller. Dabei ist sie eine zwittrige Gattung. Sie changiert zwischen fiktionalem und faktualem Erzählen, zwischen Memoir und Erfindung, Wirklichkeit und Täuschung. Das Erzählte wird verbürgt mit dem Namen der Autor*in. Das eigene Leben, aber als Roman? Im ersten Teil des... weiterlesen
Der Mythos von der ‚Neuen Mittelklasse‘ und die Gegenwartsliteratur: Anke Stelling, Leif Randt, Deniz Ohde, u.a.
Kaum ein Begriff erwies sich in den gesellschaftsdiagnostischen Debatten der vergangenen Jahre so erfolgreich und anschlussfähig wie der von dem Soziologen Andreas Reckwitz geprägte Begriff der ‚Neuen Mittelklasse‘. Die Bezeichnung überzeugt in Journalismus, Kultur und Wissenschaft wohl nicht zuletzt deshalb, weil er ihnen eine besondere gesellschaftstragende Relevanz zuspricht und überhaupt die Selbstbilder bestimmter Milieus zu bestätigen scheint. Darüber hinaus steht... weiterlesen
Literatur und Kapitalozän: Ursula K. Le Guin und Octavia E. Butler
Immer mehr Wissenschaftler:innen bestätigen die These, dass wir in einem neuen geologischen Zeitalter leben. Es wird das Anthropozän genannt. Der Name soll zum Ausdruck bringen, dass „die Menschheit“ zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Doch wer ist eigentlich mit Menschheit gemeint? Wann hat es angefangen? Und warum? Zwei Autorinnen,... weiterlesen
Queer Temporalities: Between Utopia and Negativity
Capitalism, as Walter Benjamin has once put it, relies on the idea of a “progression through a homogenous, empty time”. He suggests that it is our very understanding and affective relation to a progressive, continuous, and linear notion of time that solidifies and reproduces it. Since its advent, queer theory has asked how heteronormativity relies on linear notions of time... weiterlesen
Simone Weil, Gewerkschafterin
Simone Weil gehört zu den facettenreichsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Als eine der ersten Frauen studierte sie in den 1920er Jahren Philosophie an der prestigeträchtigen Pariser École Normale Supérieure. Neben dem Studium und später als Philosophielehrerin engagierte sie sich in der französischen Arbeiter*innenbewegung, war kurzzeitig Hilfsarbeiterin in Metallfabriken und kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg. Mit ihrer Familie floh sie später ins... weiterlesen
Rassismus: What’s Class Got To Do With It?
Die Rassismuskritik hat in Deutschland in den letzten Jahren deutlich Aufwind bekommen. Kämpfe Geflüchteter, migrantischer Widerstand gegen rassistischen Terror und die Proteste um Black Lives Matter haben das Thema Rassismus nach Jahrzehnten des Schweigens endlich auf die Agenda gebracht. Gleichzeitig haben Konzepte wie struktureller und alltäglicher Rassismus, weiße Privilegien, kulturelle Aneignung oder Mikro-Aggression Eingang in die mediale Diskussion erhalten. ... weiterlesen
Underwriting memory: Affizierung, rassistische Gewalt und enteignete Erinnerung
Nach Bekanntwerden der NSU-Morde haben antirassistische und migrantische Initiativen verstärkt auf die Verleugnung struktureller rassistischer Gewalt hingewiesen und die Aberkennung von Trauer und Verlust verurteilt, die die Betroffenen erfahren. Diese Initiativen haben politische Archive affektiven Gedenkens und alternativer Aufklärung gegründet, die sich gegen strukturelle Opfer-Täter-Umkehrungen und die Entwirklichungen von Trauer und Verlust wenden. Diese Archive werfen die Frage auf, wie... weiterlesen
Gemeinschaft und Gemeinsinn. Zu zwei zentralen Begriffen der politischen Gegenwart
Gemeinschaft ist vielleicht der politische Begriff der Stunde. Er taucht nicht nur in den Selbst- und Fremdbeschreibungen von rassifizierten, diasporischen, religiösen und nicht-heteronormativen ›Communities‹ sowie von Subkulturen und Fangemeinden auf. Ebenso findet er sich in der etablierten politischen Rhetorik. Figuren wie Sarah Wagenknecht bringen den »Gemeinsinn« gegen »Lifestyle-Linke« in Stellung. Aber wo liegt dieser Sinn, der als Leitbild kollektiven Lebens... weiterlesen
ooo – Object Oriented Ontology – was ist es und was kann es?
Unter dem Titel Object Oriented Ontology hat sich im englischsprachigen Raum eine Denkrichtung entwickelt, die die Dinge in den Blick nimmt (aber gibt es überhaupt Dinge?). Sie bezieht sich grob auf Heidegger, europäische und buddhistische Phänomenologie, aber auch auf den spekulativen Realismus. Timothy Morton prägte hierbei den Begriff der Hyperobjects. Bei dem Begriff geht es um die Anerkennung der Schwierigkeiten,... weiterlesen
Recht auf Stadt und die Produktion des Raumes bei Henri Lefebvre
Der französische Philosoph und Soziologe Henri Lefebvre gilt als ein schillernder Vertreter des sogenannten westlichen Marxismus des 20. Jahrhunderts. Er war nicht nur ein wichtiger Impulsgeber der Pariser Studentenrevolte im Mai 1968 und praxisphilosophischer Widersacher seines strukturalistischen Zeitgenossen Louis Althusser. Mit seinen Forschungen zu Stadt und Raum ist er heute zu einem wichtigen Stichwortgeber in der Stadtsoziologie und in sozialen... weiterlesen
Historiker*innenstreit 2.0 revisited – Postkoloniale Herausforderungen erinnerungspolitischer Debatten der Gegenwart
Der Holocaust galt lange als »emblematische Gedächtnisikone« (Dan Diner) und Masternarrativ im Forschungsfeld der genozidalen Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts wird in den transnational und interdisziplinär ausgerichteten Memory Studies – ausgehend von der postkolonialen Kritik – verstärkt die Frage konkurrierender Gedächtnisse an Holocaust und kolonialen Genoziden diskutiert, die sich jüngst in heftigen Debatten entladen, die... weiterlesen
Historiker*innenstreit 2.0 revisited – Wie weitergehen?
Antisemitismus und Kolonialrassismus, aber auch Holocaust und koloniale Genozide wurden in der Forschung zumeist getrennt voneinander untersucht. Geht man jedoch davon aus, dass die Entstehung des modernen Rassismus ein transnationales Projekt war, das mit der Herausbildung von globalen kolonialen Eroberungs- und Machtstrukturen genauso wie mit der langen Geschichte anti-jüdischer Ressentiments eng verwoben war, dann stellt sich die Frage, ob sich... weiterlesen
abgesagt [Peter Sloterdijk: zwischen politischer Provokation und wissenschaftlichem Diskurs]
Das Seminar muss leider entfallen. [Peter Sloterdijk wird in der internationalen Wissenschaft viel rezipiert, wie die Übersetzungen seiner Werke in zahlreiche Fremdsprachen, seine regelmäßige Präsenz als Referenzautor in Hochschulveranstaltungen und die ihm gewidmeten Monographien, Sonderhefte und Sammelbände zeigen. In Deutschland ist er jedoch vor allem für seine kontroverse Rolle als öffentlicher Intellektueller bekannt, als der er immer wieder heftige Debatten... weiterlesen
Weirde Schreibwerkstatt: Workshop zu Weird Fiction
Wo fängt Realismus an? Ab wann ist ein Text realistisch? Wo fängt die Realität an? Für Moritz Baßler gebietet ein mittelmäßiger Realismus den Mainstream der Gegenwartsliteratur, der sich immer und immer wieder bloß selbstbestätigt – Werbung für die Realität. Wir schauen in diesem Workshop auf das unrealistische Erzählen, das den Zuständen versucht, zu entfliehen. Doch das ist gar nicht so... weiterlesen
Nach der Erinnerung? Literatur und Nationalsozialismus heute
Der jüngste Überfall auf Israel und der Krieg im Gazastreifen haben die Debatten um die deutsche Erinnerungspolitik neu entfacht. Nunmehr seit Jahrzehnten fungiert Erinnerung in der Bundesrepublik als konzeptuelle Klammer für die gesellschaftliche Anerkennung historischer Schuld und die Bewahrung von Demokratie und Menschenrechten. Doch das Ende der Zeitzeug*innenschaft, und mit ihr die Ablösung von unmittelbarer, persönlicher Erfahrung, stellt diesen zentralen... weiterlesen
Klimakrise – is there no alternative? Leugnung, Apathie, Anpassung und Widerstand in einer sich erwärmenden Welt
Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt zeugen davon: in der Atmosphäre, im Ozean, in der Kryosphäre und der Biosphäre haben rapide Veränderungen stattgefunden. Mag die Planung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen auch vorangeschritten sein, die globalen Treibhausgasemissionen machen es schon jetzt mehr als wahrscheinlich, dass der Schwellenwert 1,5 Grad Celsius in diesem oder nächsten Jahrzehnt überschritten sein wird. So... weiterlesen



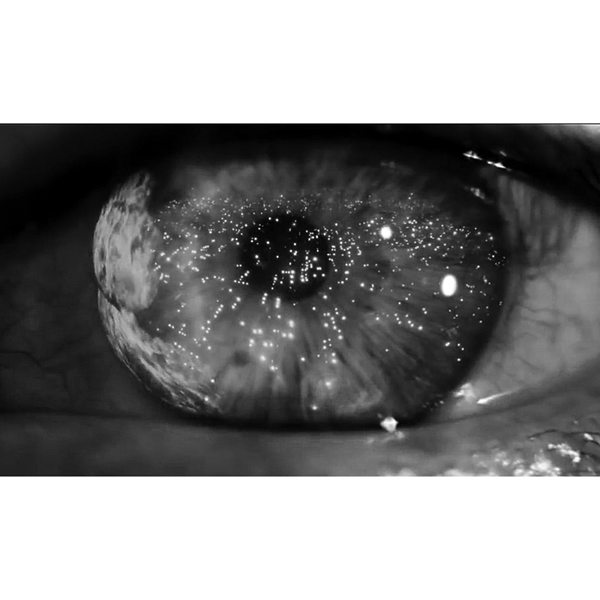





















![abgesagt [Peter Sloterdijk: zwischen politischer Provokation und wissenschaftlichem Diskurs]](https://lfbrecht.de/wp-content/uploads/2023/10/Peter_Sloterdijk_Karlsruhe_07-2009_IMGP30191.jpg)


