
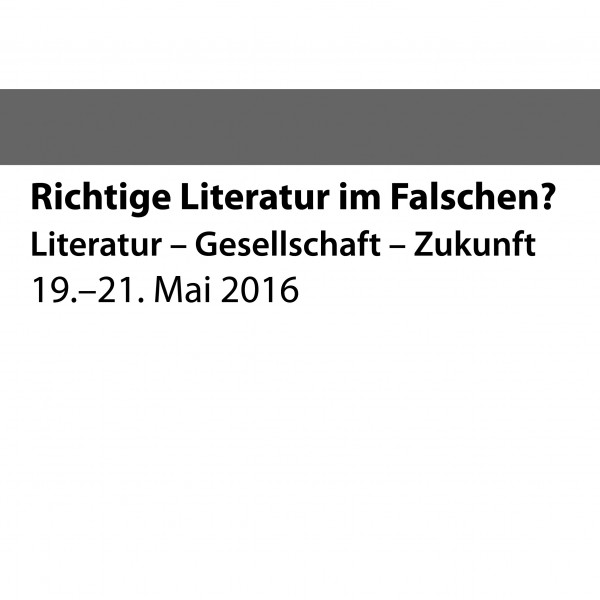
Literatur – Gesellschaft – Zukunft (Tag 1)
10:00-10:30 Uhr: Begrüßung/ Einführung
10:30-12:30 Uhr: SEKTION I
Die Zukunft des Betriebs VERSUS die Zukunft des Untergrunds
Sektionsleitung: Enno Stahl
Input-Referate: Florian Kessler, Ann Cotten
12:30-14:00 Uhr: Pause
14:00-16:00 Uhr: SEKTION II
Die Zukunft der Literatur – Chancen des Realismus
Sektionsleitung: Enno Stahl
Input-Referat: Bernd Stegemann
16:00-16:30 Uhr: Pause
16:30-18:30 Uhr: SEKTION III
Die Zukunft der Gesellschaft – Kollaboration
Sektionsleitung: Ingar Solty
Input-Referat: Mark Terkessidis
***
Nähere Informationen zu den einzelnen Sektionen:
SEKTION I: Die Zukunft des Betriebs VERSUS die Zukunft des Untergrunds
Die strukturellen Bedingungen von Literatur werden in periodischen Abständen heftig diskutiert, so auch jetzt. Welche Ästhetiken erreichen welche Öffentlichkeiten? Unter welchen Anforderungen stehen Autorinnen und Autoren, unter welchen die anderen Akteurinnen und Akteure des literarischen Feldes? Wie können sie vermeiden, dass Leserinnen und Leser zu "Endkunden" mutieren? Wer solche Fragen stellt, fragt nach den ökonomischen und politischen Rahmungen von Literatur - und muss in Betracht ziehen, nach welchen Spielregeln die Märkte für Literatur und der Betrieb, also die damit verbundenen Funktionäre und Dienstleister, funktionieren.
Florian Kessler argumentiert, dass sich die stillschweigend wirkenden Regeln des Literaturbetriebs derzeit rapide ändern und dass dabei gerade kritische Literatur und Untergrundsgefühle zu immer billigeren Dienstleistungen verkommen. Das Ringen um ein gutes Leben muss daher unbedingt auch ein Ringen um einen anderen Literaturbetrieb bedeuten.
Ann Cotten empört sich darüber, dass es in Florian Kesslers Narrativ kein Entkommen aus dem Betrieb bzw. dem Markt gäbe, dessen Macht als Mechanismus und Dispositiv sich übertriebener Weise auch auf Protest-, Sub- und Gegenkulturen erstrecken soll. Alles, womit man einen Text schreibe, meint sie, sei jenseits vom Betrieb, der sich erst später den bearbeiteten Rohstoff einkauft. Wie universell ist der Terminus „Betrieb“ und das Beschreibungsvokabular der Marktwirtschaft, wie sie im „Westen“ unterrichtet wurde und wird? Diese Frage trägt, wie sich zeigt, weitreichende Konsequenzen für das Handeln und nicht zuletzt auch für strategische ästhetische Entscheidungen.
SEKTION II : Die Zukunft der Literatur – Chancen des Realismus
Realistische Darstellungsformen werden in aktuellen Literaturdiskursen häufig belächelt – oder sie werden stillschweigend als gängigste, als eh-schon-praktizierte Gestaltungs-Konvention vorausgesetzt, die keiner Problematisierung mehr bedürfe. Doch was ist überhaupt ein zeitgenössischer Realismus? Kritisch-realistische, sozial intervenierende Ausdrucksweisen und Themenfelder sind häufig verpönt, an ihre Stelle ist die totale Ambivalenz postmoderner Skepsis getreten, die jeglicher ernst gemeinter, jeglicher wahrhaft engagierter Aussage misstraut, bzw. sie ironisiert oder mit dem Hinweis auf die allgegenwärtige Kontingenz aller Erscheinungen relativiert. Vor diesem Hintergrund herrschten aktuell – so Bernd Stegemann in seinem Buch „Lob des Realismus“ – entweder ein „Commercial Realism“, die einfache Abbildung etwa der Hollywood-Ästhetik, die wahllos Realitätspartikel aufnimmt, ohne sie in einen dialektischen Zusammenhang mit den real wirkenden Kräften in der Gesellschaft zu stellen. Oder der „postmoderne Realismus“, der seine Lehren aus der historischen Avantgarde gezogen, deren Formbrüche übernommen, aber dabei ihres antinomischen Gehalts beraubt hat. Der postmoderne Realismus erschöpft sich in Selbstreferenz, komplexen Zeichensystemen und Spiegelfechtereien, hinter denen die neoliberale Verfasstheit des Wirtschafts- und Gesellschaftssystem eben gerade nicht auftaucht, sondern bewusst zum Verschwinden gebracht wird.
Was kann heute und in Zukunft ein wirklicher Realismus, der seinen Namen verdient, erreichen? Ein Realismus als „dialektische Kunst“, „die eine gemeinsame Erfahrung von Realität provoziert“ (Stegemann), ein Realismus, der die soziale Abhängigkeit seiner Figuren, aber auch ihre Kämpfe gegen diese Abhängigkeiten dokumentiert. Wie müsste ein solcher Realismus aussehen, welche Chancen hätte er, sich tatsächlich gesellschaftlich auszuwirken – bzw. muss er das? Welche ästhetischen Herausforderungen, formal und stilistisch, stellen sich für einen neuen Realismus?
SEKTION III: Die Zukunft der Gesellschaft – Kollaboration
Prognosen über eine zukünftige Entwicklung der Gesellschaft abzugeben, ist schwierig, womöglich aussichtslos. Zu unübersichtlich ist die Welt in globalem Maßstab, fluide Gebilde von Kraftoszillationen, atemlos hechelt die etablierte Politik den Ereignissen hinterher, die von historischer Willkür und Kontingenz geprägt zu sein scheinen. Die großen Utopien hält man für ausgeträumt, Dystopien drängen sich auf, aber muss es wirklich so schlimm kommen? Sind wir wirklich alle nur ohnmächtig dem katatonen Sich-Ereignen von politischen und historischen Tatsachen ausgeliefert oder gibt es noch autonome Handlungsmöglichkeiten, unsere Umwelt (und damit auch unsere Zukunft) selbst gestaltend zu beeinflussen?
Ein Ansatz, der sich dieser Problematik stellt und „ethische, praktisch-philosophische handlungsbegründende Leitprinzipien des Wandels“ formulieren möchte, ist Mark Terkessidis' Idee der Kollaboration. Kollaboration wird, seinem pejorativem Unterton enthoben, als kreative Zusammenarbeit, als Austauschprozess freier Individuen aufgefasst.
Terkessidis reagiert damit auf die Krise des Staates angesichts des neo-liberalen Rückbaus zahlreicher funktioneller Ordnungsstrukturen. Viele Menschen verlassen sich nicht mehr auf die öffentlichen Organe de Verwaltung, sondern nehmen – etwa in Fragen der Infrastruktur – die Dinge selbst in die Hand. Über Car Sharing und Crowd Funding hat sich eine selbst organisierte Kultur des Teilens entwickelt. In Kultur und Bildung ist Kollaboration schon längst gängige Praxis. An Kollaboration, so Terkessidis, führt kein Weg mehr vorbei, auch etwa angesichts faktisch multi-ethnischer Gesellschaften, die belegen, dass Vielheit sich nicht auflösen oder zurückdrängen lässt. Vielmehr können diese hybriden Gemeinschaften sich nur dann befriedigend entwickeln, wenn alle Teile einvernehmlich zusammenwirken. Gerade wenn man das große Ganze eventuell nicht immer verändern kann, sieht Terkessidis „die Füllung der Zwischenräume mit kollaborativen Herangehensweisen“ als wichtigen Schritt „in Richtung einer vertieften Demokratie, eines besseren Zusammenlebens, gerechter verteilter Bildungschancen oder einer neuen Qualität von Arbeitsbedingungen“. Im Gegensatz zur bloßen Kooperation, die Terkessidis als zeitlich befristete Zusammenarbeit betrachtet, ist Kollaboration seinem Verständnis nach „eine Zusammenarbeit, bei der die Akteure einsehen, dass sie selbst im Prozess verändert werden und diesen Wandel sogar begrüßen.“ Dieses Konzept wird dahingehend diskutiert, ob sich darin produktive Ansätze für einen wahrhaft gestalterischen Umgang mit Zukunftsfragen ergeben.

